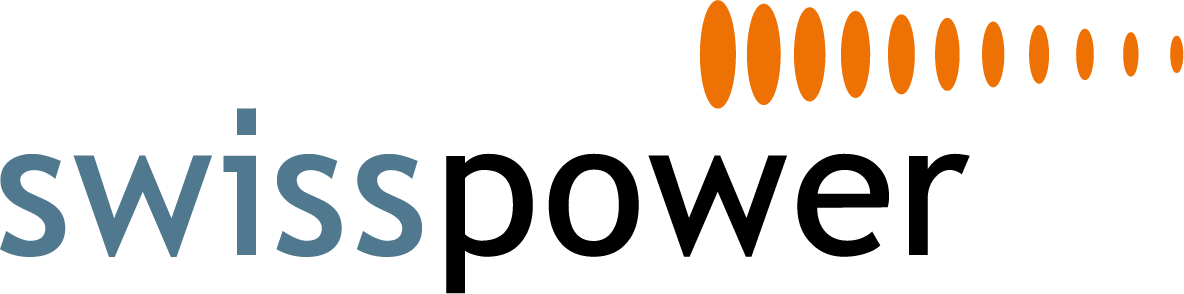Auch für kleine und mittlere Stadtwerke hat Innovation einen immer grösseren Stellenwert. Welche Themen für sie wichtig sind und wie ihnen dabei Kooperationen helfen, erklären Christoph Woodtli, Innovations- und Projektmanager bei der Energie Thun AG, und Beat Pretali, Projektleiter Energieeffizienz und Innovation bei den Technischen Betrieben Kreuzlingen.
Welche Bedeutung hat Innovation für Ihr Stadtwerk?
Christoph Woodtli: In unserem Unternehmen herrschte früh das Bewusstsein, dass sich in der Energiebranche grosse Veränderungen abzeichnen. Deshalb wurde schon 2011 meine Stelle des Innovationsmanagers geschaffen. Es ist wichtig, die Innovation voranzutreiben, solange wir noch die Mittel dazu haben.
Beat Pretali: Innovation hat für uns einen immer grösseren Stellenwert. Denn technischer Wandel, Energiestrategie 2050, Smart Grid und Digitalisierung im Allgemeinen sind nur einige neue Rahmenbedingungen, die bisherige Technologien und Geschäftsmodelle in Frage stellen.
Welche Innovationsthemen sind aus Ihrer Sicht für Stadtwerke besonders wichtig?
Christoph Woodtli: Erstens die Elektromobilität. Wir erhalten immer mehr Anfragen dazu, vor allem zur Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern und Tiefgaragen. Zweitens soll sich Thun zu einer Smart City entwickeln und wir wollen dabei eine zentrale Rolle spielen. So wandeln wir uns vom Versorger zum Betreiber einer lokalen Energiedrehscheibe und verzahnen die zahlreichen Partner miteinander.
Beat Pretali: Die wichtigsten Innovationsthemen hängen vom Auftrag und von der Positionierung des jeweiligen Stadtwerks am Markt ab. Unser Fokus liegt auf dem Smart Grid und anderen Innovationsthemen rund um die Netze. Wir bleiben also nahe am bisherigen Kerngeschäft. Eine Diversifikation steht nicht im Vordergrund.
Bei welchen Innovationsthemen macht eine Kooperation mehrerer Stadtwerke am meisten Sinn?
Christoph Woodtli: Kooperationen sind in allen Bereichen sinnvoll. Doch die Erfahrung zeigt: Sie lassen sich vor allem bei neuen Themen realisieren, bei denen man gemeinsam auf der «grünen Wiese» startet. Das gilt etwa für die LoRaWAN-Technologie. Bei der Elektromobilität hingegen ist eine Zusammenarbeit schwieriger, weil die Stadtwerke schon unterschiedlich eingespurt sind.
Beat Pretali: Kooperationen machen vor allem bei Markt- und Branchentrends Sinn, die zwar absehbar sind, deren Wirkung aber noch unklar ist. Hier tun gerade kleinere Stadtwerke wie wir gut daran, Ressourcen zu bündeln. Die Herausforderungen in Bereichen wie etwa Big Data, Smart Grid und Elektromobilität lassen sich kaum auf lokaler Ebene lösen.
Ihr Unternehmen engagiert sich bei Swisspower Innovation. Wie profitieren Sie von dieser Kooperation?
Christoph Woodtli: Wir schätzen das Trend- und das Start-up-Scouting, weil wir dadurch nichts verpassen und wichtige Kontakte erhalten. Nützlich ist auch der institutionalisierte Austausch mit den anderen Stadtwerken. Und durch regelmässige Informationen, Inputs und Anfragen sorgt Swisspower Innovation dafür, dass wir an den Themen dranbleiben. Ohne solche externen Impulse würde das Innovationsmanagement bei uns wegen der Arbeiten fürs Tagesgeschäft oftmals zu kurz kommen.
Beat Pretali: Swisspower Innovation ist für uns eine wertvolle Inspirations- und Austauschplattform. Wir setzen uns dadurch mit den relevanten Themen und Entwicklungen auseinander und erkennen die Handlungsoptionen. Bei Technologien und Methoden verschafft uns Swisspower Innovation den Zugang zu Wissen und Kompetenzen.
Welche Massnahmen haben Sie konkret schon umgesetzt?
Christoph Woodtli: Wir arbeiten einerseits in der AG Smart City mit und haben uns andererseits an einer von Swisspower Innovation koordinierten Ausschreibung zum Thema Elektromobilität beteiligt. Zudem dient die Studie «Stadtwerk 2025» unserem Verwaltungsrat als Input für die Strategieüberprüfung.
Beat Pretali: Auch wir sind Teil der AG Smart City und sammeln in einem Feldtest Erfahrungen mit der LoRaWAN-Technologie. Durch die Kooperation haben wir unser Eigenverbrauchsmodell überarbeitet und in dieser Form eingeführt. Gemeinsam mussten wir jedoch auch erkennen, dass unsere Idee eines virtuellen Speichers den regulatorischen Vorgaben zurzeit nicht entspricht.